
Nachhaltiger Baustoff aus Verbrennungsrückständen entwickelt
LINZ SERVICE Bereich Abfall 11.07.2025 | Erstmals ist es möglich, Rückstände aus der Restmüllverbrennung in der Bauwirtschaft einzusetzen.
Meilenstein in der heimischen Bauwirtschaft
Gemeinsam mit Partnern aus Industrie, Forschung und öffentlicher Hand ist LINZ AG ABFALL Teil eines Projektes, in dem aus Rückständen der Restabfallverbrennung ein genormter Baustoff entwickelt wurde. Nach langjähriger Forschung und nun erfolgter CE-Zertifizierung gilt diese aus den Verbrennungsrückständen gewonnene Gesteinsmischung als genormter Baustoff und kann als Zuschlagstoff für die Betonerzeugung verwendet werden. Damit wird es künftig möglich sein, einen Beitrag zu Ressourcenschonung, Klimaschutz und Verringerung des Deponievolumens zu leisten.

Üblicherweise werden für die Betonherstellung natürliche Materialien wie Sand oder Kies eingesetzt. Diese müssen jedoch zuvor der Natur in Sand- oder Kiesgruben entnommen werden. Die Neuerung besteht nun darin, dass 10 – 20 Prozent des sonst notwendigen Sandes oder Kieses über die Zugabe von aufbereiteter, gewaschener Schlacke ersetzt werden können.
Die so hergestellte neue Art der Gesteinsmischung erfüllt alle technischen und ökologischen Anforderungen an einen hochwertigen, normgerechten Baustoff für die Verwendung im Betonbau. Dies wurde jüngst von einer unabhängigen Prüfstelle durch Ausstellung eines CE-Zertifikats bestätigt.
Damit steht ab sofort ein nachhaltiger und ressourcenschonender Baustoff zur Verfügung. Jetzt gilt es, die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen für den Einsatz des neuen Baustoffs zu schaffen.

Enge Zusammenarbeit als Innovationstreiber
Möglich wurde die Entwicklung des innovativen Verfahrens durch ein mehrjähriges Kooperationsprojekt zwischen der Wiener Magistratsabteilung 48, der LINZ AG (Bereich Abfall), Brantner green solutions und Wopfinger Transportbeton mit wissenschaftlicher Begleitung des Christian-Doppler-Labors der TU Wien. Das Christian-Doppler-Labor fungierte dabei als Förderprogramm des Wirtschaftsministeriums, mit dem Ziel, Wirtschaft und Wissenschaft miteinander zu verbinden. Das erfolgreiche Projekt zeigt beispielhaft, wie die enge Zusammenarbeit zwischen kommunalen Partnern, Industrie und Wissenschaft zum Innovationstreiber wird und veranschaulicht, wie Kreislaufwirtschaft in der Baubranche konkret gelebt werden kann.
Technologisch führend: Der Schlackenrecycling-Prozess
Im niederösterreichischen Hohenruppersdorf setzt Kreislaufwirtschaftsspezialist Brantner green solutions bei der Produktion des neuen Baustoffs auf den sogenannten Schlackenrecycling-Prozess. Dabei können mineralische Rückstände aus der thermischen Abfallverwertung beinahe vollständig einer Verwertung zugeführt werden:
- Rund 80 % der Schlacke werden zu hochwertiger Gesteinskörnung (Ersatz für Sand oder Kies).
- Etwa 10 % sind wertvolle Metalle wie Eisen, Aluminium und Kupfer, die rückgewonnen und recycelt werden.
- Nur 10 % verbleiben als nicht verwertbarer Rest und werden deponiert.
Durch den Einsatz von Schlacke können natürliche Ressourcen wie Sand, Kies und gebrochener Stein ersetzt werden. Dies trägt zur Ressourcenschonung und zu weniger Eingriffen in die Natur bei. Die Rückgewinnung von Metallen aus Abfallströmen reduziert den Bedarf an primären Metallen – und damit den Energieverbrauch und die CO₂-Emissionen. Durch die Verwendung von Rückständen aus der Restmüllverbrennung in der Bauwirtschaft vermindert sich auch die sonst erforderliche Ablagerung auf Reststoffdeponien – Deponievolumen wird geschont und ein weiterer Schritt in Richtung „Zero Waste“ oder „Null Verschwendung“ getan.
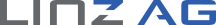
Erhalten Sie regelmäßig exklusive Neuigkeiten und Aktionen per Mail!